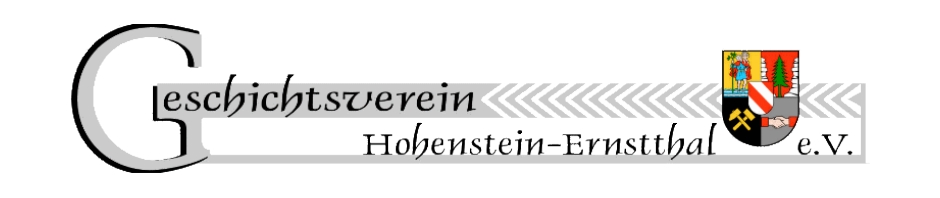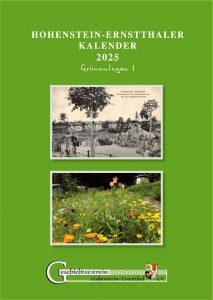
Der Quell heutiger Kleingartenanlagen war ein Kinderspielplatz. Vor 160 Jahren wurde nach einer Idee des Arztes Dr. Schreber in Leipzig ein erster Schreberplatz genannter Spielplatz eingerichtet. Damit sollten die Lebensbedingungen der unter den Auswirkungen der schnell wachsenden Industrialisierung und Verstädterung gesundheitlich besonders leidenden Kinder durch Spielmöglichkeiten bei „Licht, Luft und Sonne“ verbessert werden. Bald legte man um diesen Platz Kinderbeete an, die zu Familienbeeten wurden und aus denen schließlich die ersten „Schrebergartenvereine“ entstanden. Die Bedeutung der verschiedenen ursprünglich mit prägenden Lebensreformbewegungen wurde geringer und die Gartenkolonien entwickelten ein bis heute ständigem Wandel unterliegendes vielfältiges Eigenleben.
In Kriegs- und Mangelzeiten lag das Augenmerk stärker auf der Ertragsfähigkeit der Gärten zur Selbst- und auch Fremdversorgung mit frischem Obst, Gemüse sowie Schnittblumen. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg war die Illumination der Anlagen und Festplätze zu unter teils schwierigen Bedingungen organisierten gern besuchten Gartenfesten Ausdruck eines in mehrerer Hinsicht befreiten Lebens. Später wandelten sich viele Gärten zu Oasen der Ruhe und Erholung, wo besonders in den Sommermonaten viele Feierabende und Wochenenden verbracht wurden.
Infolge der gesellschaftlichen Veränderungen der 1990er Jahre verloren die vorher oft knappen und umworbenen Gärten für viele vorübergehend an Attraktivität. Sie wurden nun eher als Belastung und Mühsal in der knapper werdenden Freizeit empfunden. In jüngster Vergangenheit beginnt sich die Situation wieder leicht zu bessern. Auch der Charakter der Anlagen erfährt einen neuerlichen Wandel. So richten sich bei manchem langjährigen, eher noch auf Ertrag und penible Ordnung ausgerichteten Gärtner, der sein Gemüse noch nach Schablone pikiert hat, bei der Erwähnung von Naturgärten oder Blühwiesen gern schon einmal die Nackenhaare auf. Aber war es lange die Natur, die dem Menschen freigiebig ihre Früchte und den Raum zur Entspannung geboten hat, so ist es heute mehr und mehr an den Menschen, der immer stärker zurückweichenden Natur helfend zur Seite zu stehen, damit das Summen und Brummen in den Bäumen und Sträuchern wieder intensiver erklingen kann.
Unser diesjähriger Kalender widmet sich den Entwicklungen, die die Gartenanlagen seit ihren Anfängen in den 1860er Jahren genommen haben. Wir wollen dabei in erster Linie die Aktivitäten und Mühen der Kleingärtner würdigen, die über die Jahrzehnte immer wieder aufgewendet wurden und werden, um Brachland in Gärten zu verwandeln und diese zu erhalten und zu verschönern. Auf einen „Blumenkalender“ haben wir dabei bewusst verzichtet, denn diese sieht man sich besser in den Gärten als zu Hause an der Wand an, um sich die Fragilität des Lebens immer aufs Neue zu vergegenwärtigen. Nur eine vitale Natur ermöglicht vitales menschliches Dasein.
Wir wünschen allen Interessierten viel Freude beim Betrachten und Lesen der einzelnen Monatsblätter.
Henry Kreul
Die Kalender sind zum gewohnten Preis von 7,50 Euro direkt beim Geschichtsverein erhältlich.